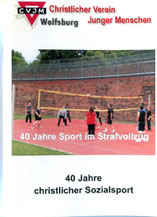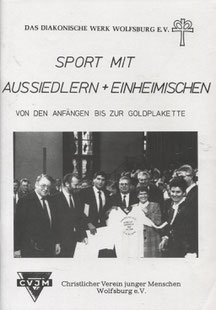Thema des Monats September 2025: Ausführungen zum Thema "Sport und Migration" von Professor Dr. Dr. Bernd Wedemeyer-Kolwe vom Niedersächsischen Institut für Sportgeschichte: Historisch und auf lange Sicht gesehen, gelingt Integration im Sport eher, wenn die Angebote der Sportorganisationen auf die Bedürfnisse der Migranten zugeschnitten sind, wenn deren Bewegungskulturen und Körperkonzepte in die eigenen Angebote mit einbezogen werden und sie mit Sportangeboten der Wahlheimat verkoppelt sind und wenn Migrantinnen und Migranten schon früh Aufgaben und Verantwortung in den Sportvereinen übernehmen.

Das Thema Sport und Migration beschäftigt den Sport in Deutschland seit über 100 Jahren. Allein seit 1945 gibt es mit den Flüchtlingen nach dem Weltkrieg, den „Gastarbeitern“ der 1960er Jahren, den Neubürgern aus der Sowjetunion seit 1989 und der aktuellen Migration schon vier unterschiedliche Situationen, in denen große Eingliederungsbestrebungen in den Vereinssport zu verzeichnen sind und die Sportorganisationen darauf intensiv reagiert haben. Nicht alles gelang, aber einiges konnte in Bewegung gesetzt werden.
Die Sportgeschichtsforschung ist anhand der historischen Analyse von Migration und Sport dabei zu folgenden periodenübergreifenden Schlüssen einer gelingenden Integration in den Sport gekommen: Integration im Sport ist geschlechtsabhängig. In der Regel stell(t)en überwiegend Männer die Vorstände und Frauensport war lange Zeit untergeordnet. Trotz allmählicher Angleichung der Geschlechter hat es ein muslimisches Mädchen im Sport schwerer als ein deutscher Junge. Integration im Sport ist leistungsabhängig: Der deutsche (Leistungs)Sport benötigt(e) stets erfolgreichen Nachwuchs und investiert in leistungsstarke Kinder und Jugendliche. Sportlich veranlagten Ausländern gelingt daher auch sozial eine Integration in den Sport besser, andere Migranten geben eher auf. Integration im Sport ist sportartenabhängig Sportarten aus anderen Gesellschaften müssen kulturell integrierbar oder weltweit akzeptiert sein (Fussball), und sie müssen kulturgeschichtlich anpassbar sein (Yoga, Bauchtanz). Gesellschaften mit traditionellem Rollenverständnis oder Kleidungstabus (Schulschwimmen) tendieren eher zu traditionell verteilten Zuweisungen zu Sportarten (Mädchen – Gesundheitssport / Jungen – Kraftsport). Integration im Sport gelingt eher bei vorheriger Sportsozialisation: Wenn sich Sportorganisationen im Heimat- und Zielland ähneln und Migranten im Heimatland durch sportliche / sportorganisatorische Erfahrungen schon sportsozialisiert sind, gelingt eine Integration besser. Integration im Sport gelingt schlechter in Migrantensportvereinen: Lange Zeit lehnte der deutsche Sport die Bildung von Vereinen für und durch Migranten ab, auch weil man eine Zersplitterung der Einheit der Sportorganisation in viele kleine unabhängige Gruppen und damit eine Schwächung befürchtete. Die wenig fördernden Einbürgerungsbestimmungen erschwerten aber auch eine vollwertige Integration von Migranten in den (Leistungs)Sport. Auf der anderen Seite gelten Migrantensportvereine durch ihre Männerdominanz, der innernationalen Konfliktträchtigkeit im Spielbetrieb und bei den Fans und der partiellen Unterstützung religiös-politischer Tendenzen auch als integrationshemmend.
Historisch und auf lange Sicht gesehen, gelingt Integration im Sport daher eher, wenn die Angebote der Sportorganisationen auf die Bedürfnisse der Migranten zugeschnitten sind, wenn deren Bewegungskulturen und Körperkonzepte in die eigenen Angebote mit einbezogen werden und sie mit Sportangeboten der Wahlheimat verkoppelt sind und wenn Migranten schon früh Aufgaben und Verantwortung in den Sportvereinen übernehmen.